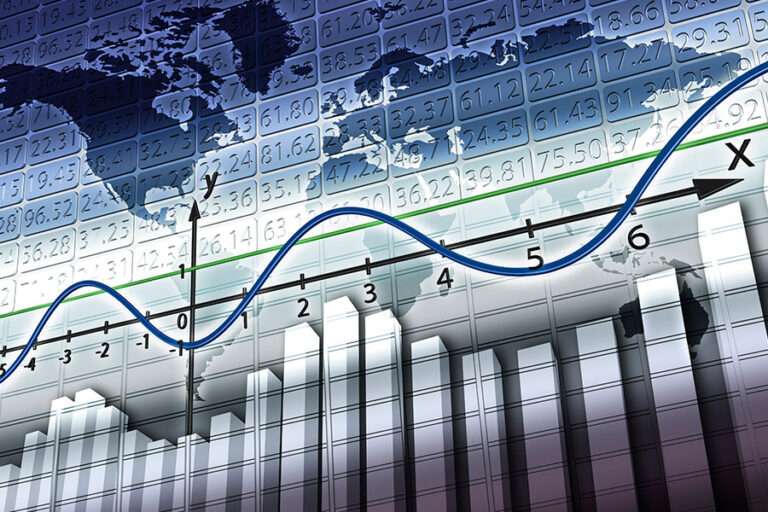Im ersten Quartal 2022 gab es bundesweit 1,74 Millionen offene Stellen. Damit wurde der Rekord vom Vorquartal übertroffen. Gegenüber dem vierten Quartal 2021 stieg die Zahl der offenen Stellen um rund 51.000 oder 3 Prozent, im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 612.500 oder 54 Prozent. Das geht aus der IAB-Stellenerhebung hervor, einer regelmäßigen Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
In Westdeutschland waren im ersten Quartal 2022 rund 1,4 Millionen offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 340.000. Die Arbeitslosen-Stellen-Relation liegt im ersten Quartal 2022 bei 1,4. Damit kommen auf 100 von den Betrieben ausgeschriebenen offenen Stellen rund 140 arbeitslos gemeldete Personen. In Westdeutschland lag der Wert bei 1,3 und in Ostdeutschland bei 1,7.
„Nicht nur die Zahl der offenen Stellen ist nach der Corona-Krise wieder stark angestiegen, auch die Zahl der Arbeitslosen ist in beiden Landesteilen gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich gesunken“, erklärt IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. „Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich die Personalsuche in vielen Bereichen wieder schwieriger gestaltet. Insgesamt zeigt sich, dass eine deutliche Erholung des Arbeitsmarkts von der Corona-Krise zu Jahresbeginn auf dem Weg war, und die Entwicklung trotz des Ukraine-Krieges bis zum Ende des ersten Quartals robust blieb“, sagt Kubis weiter. „Trotz der bisherigen Robustheit des Arbeitsmarktes dämpfen der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe die wirtschaftliche Entwicklung. Es besteht das Risiko eines starken Einbruchs am Arbeitsmarkt, sollte der Krieg weiter eskalieren und es zu einem Stopp der Energielieferungen aus Russland kommen“, ergänzt IAB-Direktor Bernd Fitzenberger.
Das IAB untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im ersten Quartal 2022 lagen Antworten von rund 7.600 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vor. Die Zeitreihen zur Zahl der offenen Stellen auf Basis der IAB-Stellenerhebung sind unter https://www.iab.de/stellenerhebung/daten online veröffentlicht.