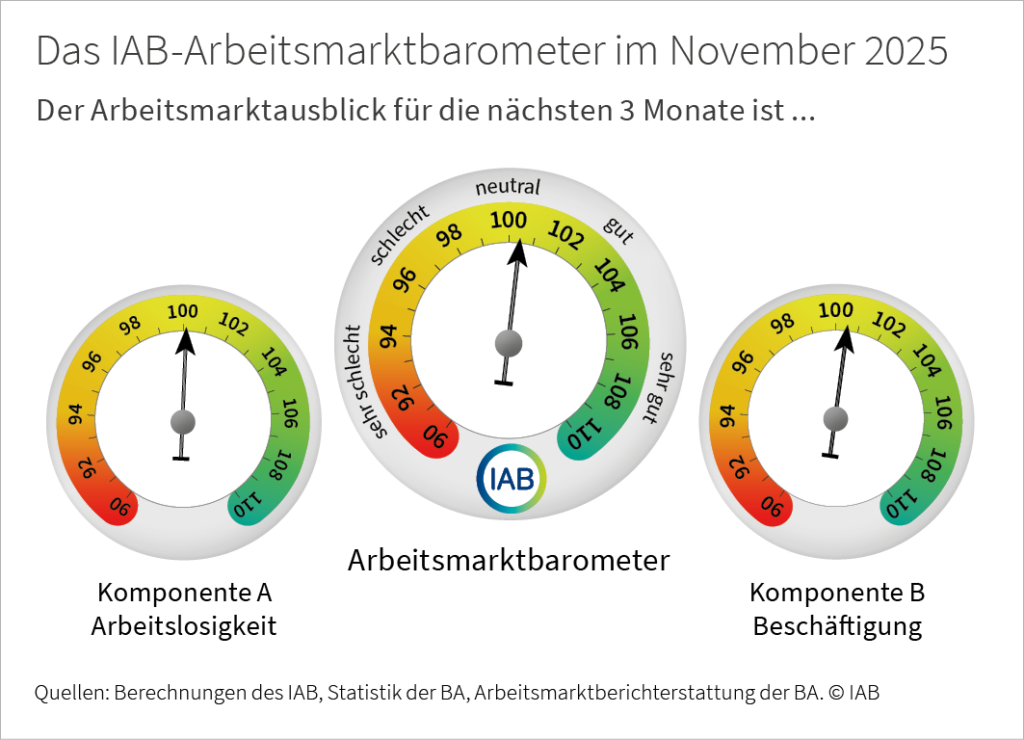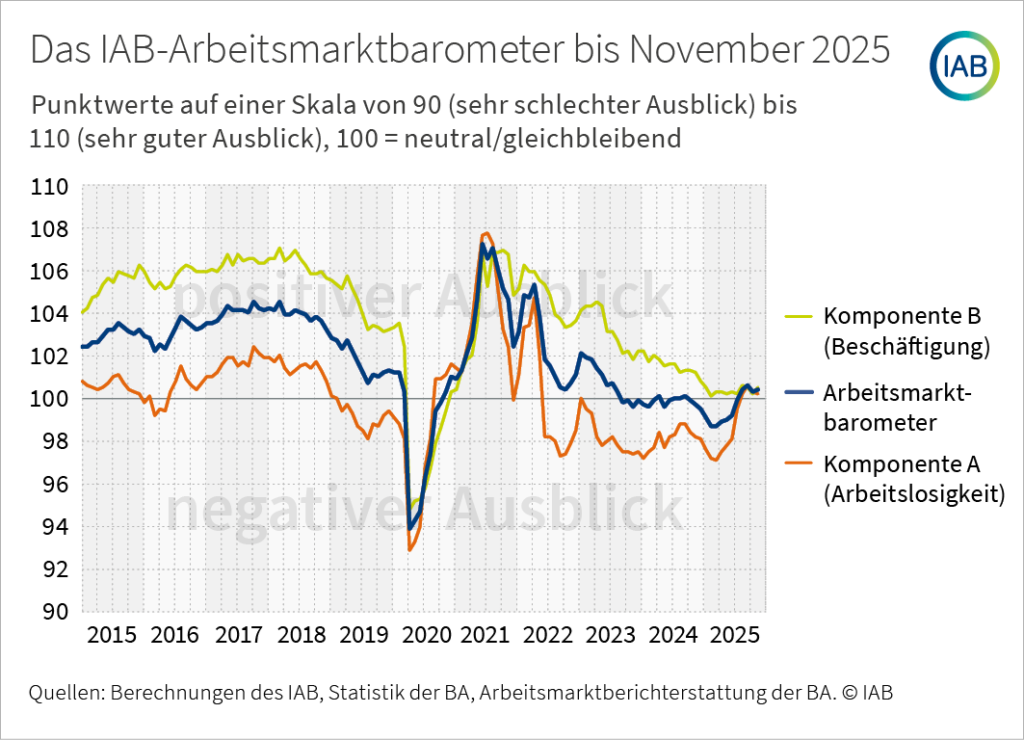Die milde und schneearme Witterung hatte auch im April 2025 einen entlastenden Effekt auf die Arbeitslosigkeit in Höhe von etwa 11.000 Personen. Insgesamt – unter Berücksichtigung der günstigen Effekte aus den Vormonaten – beträgt die wetterbedingte Entlastung rund 40.000 Personen. In den Folgemonaten baut sich dieser Effekt wieder ab: Die Arbeitslosigkeit würde im Mai demnach noch um 30.000 Personen, im Juni um 3.000 Personen und im Juli um 2.000 Personen ungünstiger ausfallen als ohne die besonderen Wettereffekte.
Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.
Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.
Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis April 2025
| Monat/Jahr | Temperatur in °C | Schneehöhe in cm | Schneefall in cm | Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit | Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| September 91 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 91 | 9,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 91 | 3,90 | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 91 | 0,48 | 0,84 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 92 | 1,37 | 1,72 | 0,14 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 92 | 2,03 | 3,04 | 0,40 | -11.813,19 | -2.776,09 |
| März 92 | 5,37 | 1,67 | 0,14 | -17.425,14 | -5.611,94 |
| April 92 | 6,72 | 1,69 | 0,06 | -19.457,80 | -2.032,66 |
| Mai 92 | 13,61 | 0,10 | 0,00 | -10.373,13 | 9.084,67 |
| Juni 92 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | -6.183,06 | 4.190,07 |
| Juli 92 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | -1.567,21 | 4.615,85 |
| August 92 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,21 |
| September 92 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 92 | 8,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 92 | 5,59 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 92 | 4,16 | 0,56 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 93 | 1,81 | 0,43 | 0,08 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 93 | -0,15 | 3,00 | 0,40 | -12.014,20 | -2.977,10 |
| März 93 | 3,01 | 4,25 | 0,12 | 691,57 | 12.705,78 |
| April 93 | 8,12 | 0,37 | 0,05 | -12.815,98 | -13.507,55 |
| Mai 93 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | -2.719,05 | 10.096,93 |
| Juni 93 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | -4.157,04 | -1.437,99 |
| Juli 93 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -1.847,66 | 2.309,38 |
| August 93 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,66 |
| September 93 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 93 | 9,41 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 93 | 2,30 | 0,92 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 93 | 2,10 | 2,20 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 94 | 3,11 | 3,26 | 0,23 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 94 | 0,30 | 3,48 | 0,46 | -9.543,05 | -505,95 |
| März 94 | 5,89 | 1,94 | 0,13 | -14.474,13 | -4.931,08 |
| April 94 | 7,37 | 0,99 | 0,08 | -14.924,65 | -450,51 |
| Mai 94 | 12,85 | 0,12 | 0,00 | -7.922,13 | 7.002,52 |
| Juni 94 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | -4.675,75 | 3.246,38 |
| Juli 94 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | -1.160,72 | 3.515,03 |
| August 94 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,72 |
| September 94 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 94 | 8,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 94 | 7,94 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 94 | 3,50 | 0,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 95 | 1,03 | 6,43 | 0,82 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 95 | 4,54 | 1,64 | 0,12 | -19.087,45 | -10.050,35 |
| März 95 | 3,40 | 2,10 | 0,29 | -17.811,13 | 1.276,32 |
| April 95 | 5,96 | 2,11 | 0,49 | 31.076,32 | 48.887,44 |
| Mai 95 | 11,60 | 0,09 | 0,00 | 14.472,87 | -16.603,45 |
| Juni 95 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 18.868,00 | 4.395,13 |
| Juli 95 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 6.685,47 | -12.182,53 |
| August 95 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.685,47 |
| September 95 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 95 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 95 | 5,13 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 95 | -0,85 | 1,68 | 0,41 | 47.494,72 | 47.494,72 |
| Januar 96 | -2,77 | 1,57 | 0,05 | 76.801,23 | 29.306,51 |
| Februar 96 | -3,49 | 6,15 | 0,70 | 56.295,34 | -20.505,90 |
| März 96 | 1,47 | 5,05 | 0,12 | 51.191,35 | -5.103,99 |
| April 96 | 6,46 | 1,58 | 0,09 | 12.348,49 | -38.842,86 |
| Mai 96 | 10,32 | 0,02 | 0,00 | 4.772,86 | -7.575,63 |
| Juni 96 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | -980,74 | -5.753,60 |
| Juli 96 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | -1.078,39 | -97,65 |
| August 96 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,39 |
| September 96 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 96 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 96 | 6,20 | 0,44 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 96 | 1,40 | 3,56 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 97 | -4,59 | 6,49 | 0,28 | 91.070,91 | 91.070,91 |
| Februar 97 | 3,63 | 1,91 | 0,15 | 29.170,89 | -61.900,02 |
| März 97 | 6,00 | 0,46 | 0,11 | 18.078,96 | -11.091,93 |
| April 97 | 6,35 | 0,28 | 0,03 | -14.266,07 | -32.345,03 |
| Mai 97 | 11,90 | 0,01 | 0,01 | -17.081,56 | -2.815,49 |
| Juni 97 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | -9.299,70 | 7.781,86 |
| Juli 97 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | -2.160,22 | 7.139,48 |
| August 97 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,22 |
| September 97 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 97 | 9,96 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 97 | 3,60 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 97 | 1,46 | 1,47 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 98 | 4,18 | 1,08 | 0,20 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 98 | 2,49 | 2,70 | 0,12 | -13.588,64 | -4.551,54 |
| März 98 | 4,80 | 0,61 | 0,22 | -25.751,96 | -12.163,32 |
| April 98 | 8,52 | 0,22 | 0,04 | -27.058,84 | -1.306,88 |
| Mai 98 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | -15.686,22 | 11.372,62 |
| Juni 98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -8.887,52 | 6.798,70 |
| Juli 98 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | -2.079,86 | 6.807,66 |
| August 98 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,86 |
| September 98 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 98 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 98 | 2,91 | 1,46 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 98 | -0,07 | 5,41 | 0,42 | 17.632,12 | 17.632,12 |
| Januar 99 | 3,54 | 1,97 | 0,34 | -786,99 | -18.419,11 |
| Februar 99 | -0,11 | 9,87 | 1,22 | 31.814,84 | 32.601,84 |
| März 99 | 4,89 | 4,22 | 0,07 | 19.928,09 | -11.886,75 |
| April 99 | 8,58 | 0,89 | 0,09 | 9.065,23 | -10.862,87 |
| Mai 99 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 5.274,75 | -3.790,47 |
| Juni 99 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | -1.696,96 | -6.971,71 |
| Juli 99 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | -1.012,03 | 684,93 |
| August 99 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,03 |
| September 99 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 99 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 99 | 4,93 | 1,37 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 99 | 2,87 | 2,63 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 00 | 0,94 | 4,66 | 0,32 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 00 | 3,17 | 3,66 | 0,25 | -8.588,27 | 448,83 |
| März 00 | 5,79 | 2,66 | 0,12 | -8.911,85 | -323,58 |
| April 00 | 7,82 | 1,01 | 0,05 | -16.438,94 | -7.527,10 |
| Mai 00 | 15,80 | 0,01 | 0,00 | -7.416,08 | 9.022,86 |
| Juni 00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | -5.909,55 | 1.506,53 |
| Juli 00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | -1.844,90 | 4.064,65 |
| August 00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,90 |
| September 00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 00 | 7,41 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 00 | 5,84 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 01 | 0,52 | 2,05 | 0,32 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 01 | 3,82 | 1,31 | 0,21 | -20.801,97 | -11.764,87 |
| März 01 | 3,12 | 2,16 | 0,34 | -18.211,42 | 2.590,55 |
| April 01 | 5,92 | 0,48 | 0,11 | -16.521,37 | 1.690,04 |
| Mai 01 | 13,56 | 0,04 | 0,00 | -7.592,14 | 8.929,23 |
| Juni 01 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | -3.052,55 | 4.539,60 |
| Juli 01 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | -696,43 | 2.356,12 |
| August 01 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,43 |
| September 01 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 01 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 01 | 6,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 01 | 1,69 | 0,86 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 02 | -0,64 | 11,24 | 0,33 | 11.936,04 | 11.936,04 |
| Februar 02 | 5,97 | 0,89 | 0,10 | -13.138,82 | -25.074,86 |
| März 02 | 6,01 | 1,34 | 0,12 | -15.199,78 | -2.060,96 |
| April 02 | 7,48 | 0,28 | 0,01 | -29.194,72 | -13.994,94 |
| Mai 02 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | -16.373,90 | 12.820,82 |
| Juni 02 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | -9.695,27 | 6.678,64 |
| Juli 02 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | -2.621,22 | 7.074,05 |
| August 02 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,22 |
| September 02 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 02 | 9,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 02 | 6,15 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 02 | 1,40 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 03 | 0,98 | 2,01 | 0,36 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 03 | -1,49 | 7,73 | 0,76 | 12.466,73 | 21.503,83 |
| März 03 | 4,03 | 2,61 | 0,01 | 564,56 | -11.902,17 |
| April 03 | 7,74 | 0,28 | 0,07 | -3.991,30 | -4.555,85 |
| Mai 03 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | -2.986,76 | 1.004,54 |
| Juni 03 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | -4.671,69 | -1.684,93 |
| Juli 03 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | -1.409,45 | 3.262,25 |
| August 03 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,45 |
| September 03 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 03 | 7,85 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| November 03 | 5,30 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 03 | 2,95 | 0,51 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 04 | 0,44 | 3,27 | 0,50 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 04 | 2,76 | 5,10 | 0,72 | -1.149,34 | 7.887,76 |
| März 04 | 2,92 | 3,42 | 0,34 | -112,99 | 1.036,36 |
| April 04 | 7,57 | 0,60 | 0,10 | -3.773,60 | -3.660,61 |
| Mai 04 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | -625,72 | 3.147,88 |
| Juni 04 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | -1.940,78 | -1.315,06 |
| Juli 04 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | -792,81 | 1.147,97 |
| August 04 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,81 |
| September 04 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 04 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 04 | 6,91 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 04 | 1,44 | 0,62 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 05 | 3,26 | 2,30 | 0,25 | -9.037,10 | -9.037,10 |
| Februar 05 | -0,30 | 8,06 | 0,97 | 14.177,61 | 23.214,71 |
| März 05 | -0,54 | 13,64 | 0,45 | 79.233,56 | 65.055,95 |
| April 05 | 9,31 | 1,20 | 0,00 | 24.299,12 | -54.934,44 |
| Mai 05 | 9,68 | 0,07 | 0,00 | 29.531,53 | 5.232,40 |
| Juni 05 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 3.377,39 | -26.154,13 |
| Juli 05 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | -2.814,85 | -6.192,24 |
| August 05 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,85 |
| September 05 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 05 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 05 | 9,18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 05 | 1,41 | 2,33 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 06 | -0,81 | 5,54 | 0,62 | 10.962,41 | 10.962,41 |
| Februar 06 | -1,71 | 7,59 | 0,77 | 24.360,77 | 13.398,36 |
| März 06 | -0,18 | 11,45 | 0,59 | 60.183,16 | 35.822,39 |
| April 06 | 5,01 | 4,20 | 0,18 | 61.365,34 | 1.182,18 |
| Mai 06 | 12,79 | 0,29 | 0,00 | 22.880,85 | -38.484,48 |
| Juni 06 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 16.196,10 | -6.684,76 |
| Juli 06 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 1.130,34 | -15.065,75 |
| August 06 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.130,34 |
| September 06 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 06 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 06 | 9,49 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 06 | 7,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 07 | 4,24 | 0,14 | 0,05 | -6.513,80 | -6.513,80 |
| Februar 07 | 2,87 | 1,40 | 0,38 | -19.220,59 | -12.706,79 |
| März 07 | 6,01 | 0,38 | 0,02 | -29.412,21 | -10.191,62 |
| April 07 | 7,86 | 0,64 | 0,24 | -13.482,71 | 15.929,51 |
| Mai 07 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 1.444,64 | 14.927,35 |
| Juni 07 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | -1.679,71 | -3.124,35 |
| Juli 07 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 3.081,58 | 4.761,29 |
| August 07 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.081,58 |
| September 07 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 07 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 07 | 6,23 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 07 | 3,75 | 1,62 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 08 | 0,78 | 1,17 | 0,08 | -6.513,80 | -6.513,80 |
| Februar 08 | 3,88 | 0,53 | 0,04 | -22.499,13 | -15.985,32 |
| März 08 | 4,83 | 0,40 | 0,08 | -33.148,21 | -10.649,08 |
| April 08 | 4,26 | 1,71 | 0,34 | -5.956,53 | 27.191,68 |
| Mai 08 | 11,33 | 0,14 | 0,01 | 10.360,46 | 16.316,99 |
| Juni 08 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 1.366,15 | -8.994,31 |
| Juli 08 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 6.088,73 | 4.722,58 |
| August 08 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.088,73 |
| September 08 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 08 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 08 | 8,10 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 08 | 2,40 | 2,31 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 09 | -1,63 | 3,45 | 0,33 | 22.829,74 | 22.829,74 |
| Februar 09 | 0,50 | 2,99 | 0,30 | 21.117,96 | -1.711,78 |
| März 09 | 2,57 | 7,41 | 0,37 | 23.644,83 | 2.526,87 |
| April 09 | 8,31 | 2,78 | 0,10 | 28.212,96 | 4.568,13 |
| Mai 09 | 11,49 | 0,06 | 0,00 | 1.218,30 | -26.994,66 |
| Juni 09 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 6.444,12 | 5.225,81 |
| Juli 09 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | -1.384,69 | -7.828,81 |
| August 09 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,69 |
| September 09 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 09 | 12,51 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 09 | 6,25 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 09 | 6,41 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 10 | -2,20 | 6,01 | 0,55 | 31.147,06 | 31.147,06 |
| Februar 10 | -2,26 | 12,50 | 0,76 | 66.398,21 | 35.251,16 |
| März 10 | 0,42 | 9,79 | 0,23 | 80.350,71 | 13.952,50 |
| April 10 | 8,05 | 0,95 | 0,03 | 51.160,88 | -29.189,83 |
| Mai 10 | 9,27 | 0,02 | 0,00 | 10.139,75 | -41.021,13 |
| Juni 10 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 8.354,92 | -1.784,83 |
| Juli 10 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | -3.732,48 | -12.087,40 |
| August 10 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,48 |
| September 10 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 10 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 10 | 6,97 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 10 | -0,98 | 6,21 | 1,12 | 37.725,83 | 37.725,83 |
| Januar 11 | -0,58 | 14,93 | 0,65 | 51.981,58 | 14.255,75 |
| Februar 11 | 1,17 | 2,22 | 0,25 | 13.800,25 | -38.181,32 |
| März 11 | 1,73 | 0,80 | 0,08 | -5.427,38 | -19.227,64 |
| April 11 | 8,69 | 0,11 | 0,00 | -26.542,93 | -21.115,55 |
| Mai 11 | 11,88 | 0,01 | 0,01 | -22.121,24 | 4.421,69 |
| Juni 11 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | -8.541,34 | 13.579,90 |
| Juli 11 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | -4.529,99 | 4.011,35 |
| August 11 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.529,99 |
| September 11 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 11 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 11 | 6,96 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 11 | 3,90 | 0,29 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 12 | 4,01 | 2,02 | 0,30 | -6.513,80 | -6.513,80 |
| Februar 12 | -3,83 | 4,18 | 0,29 | -8.854,14 | -2.340,34 |
| März 12 | 4,33 | 3,33 | 0,13 | -2.217,83 | 6.636,31 |
| April 12 | 7,88 | 0,41 | 0,00 | -13.645,38 | -11.427,55 |
| Mai 12 | 11,50 | 0,05 | 0,00 | -14.778,49 | -1.133,11 |
| Juni 12 | 14,54 | 0,01 | 0,01 | -3.934,48 | 10.844,01 |
| Juli 12 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | -4.460,59 | -526,10 |
| August 12 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,59 |
| September 12 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 12 | 7,25 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 12 | 1,62 | 3,58 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 13 | 3,46 | 1,59 | 0,10 | -6.513,80 | -6.513,80 |
| Februar 13 | -0,29 | 5,19 | 0,80 | -5.082,56 | 1.431,25 |
| März 13 | 0,34 | 5,53 | 0,51 | 13.372,41 | 18.454,96 |
| April 13 | 0,99 | 3,52 | 0,29 | 26.583,92 | 13.211,51 |
| Mai 13 | 12,72 | 0,12 | 0,00 | 20.746,03 | -5.837,89 |
| Juni 13 | 12,58 | 0,01 | 0,01 | 9.068,14 | -11.677,89 |
| Juli 13 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 4.614,94 | -4.453,19 |
| August 13 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.614,94 |
| September 13 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 13 | 10,82 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 13 | 9,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 13 | 2,42 | 0,49 | 0,10 | -3.359,76 | -3.359,76 |
| Januar 14 | 4,60 | 0,19 | 0,02 | -11.872,15 | -8.512,39 |
| Februar 14 | 1,79 | 1,33 | 0,15 | -23.850,83 | -11.978,68 |
| März 14 | 5,56 | 0,22 | 0,03 | -29.538,31 | -5.687,48 |
| April 14 | 9,31 | 0,06 | 0,03 | -42.611,16 | -13.072,85 |
| Mai 14 | 10,72 | 0,01 | 0,00 | -31.000,76 | 11.610,39 |
| Juni 14 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | -2.972,89 | 28.027,87 |
| Juli 14 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | -2.013,40 | 959,49 |
| August 14 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,40 |
| September 14 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 14 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 14 | 9,48 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 14 | 3,72 | 0,06 | 0,03 | -5.157,44 | -5.157,44 |
| Januar 15 | 3,98 | 1,99 | 0,26 | -7.079,01 | -1.921,58 |
| Februar 15 | 0,59 | 4,15 | 0,39 | -10.640,73 | -3.561,72 |
| März 15 | 2,76 | 2,85 | 0,06 | -21.120,02 | -10.479,29 |
| April 15 | 6,47 | 0,70 | 0,08 | -15.743,28 | 5.376,74 |
| Mai 15 | 11,62 | 0,06 | 0,00 | -4.428,35 | 11.314,93 |
| Juni 15 | 13,91 | 0,00 | 0,00 | -1.055,63 | 3.372,72 |
| Juli 15 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | -204,50 | 851,13 |
| August 15 | 20,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,50 |
| September 15 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 15 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 15 | 8,44 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 15 | 6,31 | 0,30 | 0,08 | -8.741,01 | -8.741,01 |
| Januar 16 | 4,66 | 0,52 | 0,15 | -16.404,27 | -7.663,26 |
| Februar 16 | 2,77 | 2,24 | 0,17 | -22.554,39 | -6.150,12 |
| März 16 | 1,83 | 1,24 | 0,23 | -18.770,86 | 3.783,54 |
| April 16 | 7,12 | 0,32 | 0,04 | -21.136,59 | -2.365,73 |
| Mai 16 | 9,76 | 0,13 | 0,06 | -19.521,11 | 1.615,48 |
| Juni 16 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | -1.440,37 | 18.080,74 |
| Juli 16 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | -1.271,98 | 168,39 |
| August 16 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,98 |
| September 16 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 16 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 16 | 6,15 | 0,26 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 16 | 3,85 | 0,08 | 0,01 | -5.333,02 | -5.333,02 |
| Januar 17 | 0,75 | 1,91 | 0,33 | -7.577,50 | -2.244,47 |
| Februar 17 | -1,32 | 6,78 | 0,21 | -15.679,55 | -8.102,05 |
| März 17 | 5,53 | 1,30 | 0,08 | -25.235,86 | -9.556,32 |
| April 17 | 9,11 | 0,29 | 0,00 | -30.507,56 | -5.271,70 |
| Mai 17 | 7,82 | 0,21 | 0,09 | -21.140,36 | 9.367,20 |
| Juni 17 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | -2.129,40 | 19.010,96 |
| Juli 17 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | -1.347,53 | 781,87 |
| August 17 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,53 |
| September 17 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 17 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 17 | 8,96 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 17 | 4,03 | 1,01 | 0,20 | -5.587,92 | -5.587,92 |
| Januar 18 | 3,56 | 1,83 | 0,22 | -8.154,55 | -2.566,63 |
| Februar 18 | 2,41 | 2,03 | 0,29 | -13.849,45 | -5.694,90 |
| März 18 | -0,43 | 2,40 | 0,14 | -19.586,38 | -5.736,94 |
| April 18 | 5,76 | 0,78 | 0,05 | -8.074,28 | 11.512,10 |
| Mai 18 | 13,80 | 0,02 | 0,00 | -762,90 | 7.311,39 |
| Juni 18 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | -490,37 | 272,53 |
| Juli 18 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 531,63 |
| August 18 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,26 |
| September 18 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 18 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 18 | 10,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 18 | 4,13 | 0,13 | 0,07 | -5.721,44 | -5.721,44 |
| Januar 19 | 2,33 | 1,61 | 0,29 | -9.116,21 | -3.394,77 |
| Februar 19 | 0,23 | 5,37 | 0,45 | -10.701,56 | -1.585,35 |
| März 19 | 6,06 | 1,90 | 0,07 | -19.053,91 | -8.352,35 |
| April 19 | 7,00 | 0,44 | 0,02 | -24.674,61 | -5.620,70 |
| Mai 19 | 10,48 | 0,06 | 0,00 | -14.497,65 | 10.176,96 |
| Juni 19 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | -1.722,49 | 12.775,15 |
| Juli 19 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | -915,82 | 806,67 |
| August 19 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,82 |
| September 19 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 19 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 19 | 8,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 19 | 3,83 | 0,07 | 0,03 | -5.306,95 | -5.306,95 |
| Januar 20 | 4,51 | 0,17 | 0,04 | -14.053,81 | -8.746,86 |
| Februar 20 | 3,89 | 0,40 | 0,14 | -24.493,72 | -10.439,91 |
| März 20 | 5,25 | 0,65 | 0,22 | -20.431,59 | 4.062,13 |
| April 20 | 7,06 | 0,09 | 0,02 | -31.166,38 | -10.734,78 |
| Mai 20 | 10,76 | 0,02 | 0,01 | -29.082,57 | 2.083,81 |
| Juni 20 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | -2.168,84 | 26.913,73 |
| Juli 20 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | -1.927,95 | 240,89 |
| August 20 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,95 |
| September 20 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 20 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 20 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 20 | 3,91 | 0,34 | 0,11 | -5.424,11 | -5.424,11 |
| Januar 21 | 2,96 | 1,48 | 0,29 | -9.291,94 | -3.867,83 |
| Februar 21 | 0,94 | 6,32 | 0,71 | -4.351,53 | 4.940,41 |
| März 21 | 4,64 | 2,04 | 0,05 | -12.941,09 | -8.589,56 |
| April 21 | 5,52 | 0,92 | 0,18 | -7.277,79 | 5.663,30 |
| Mai 21 | 8,23 | 0,08 | 0,01 | 5.355,57 | 12.633,36 |
| Juni 21 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | -459,36 | -5.814,93 |
| Juli 21 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 435,89 | 895,25 |
| August 21 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435,89 |
| September 21 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 21 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 21 | 8,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 21 | 3,23 | 0,78 | 0,22 | -4.476,64 | -4.476,64 |
| Januar 22 | 3,45 | 0,81 | 0,05 | -10.749,73 | -6.273,10 |
| Februar 22 | 3,28 | 1,87 | 0,22 | -19.694,28 | -8.944,54 |
| März 22 | 4,21 | 0,98 | 0,05 | -26.644,27 | -6.949,99 |
| April 22 | 7,14 | 0,34 | 0,04 | -30.704,89 | -4.060,62 |
| Mai 22 | 11,81 | 0,01 | 0,00 | -19.457,44 | 11.247,45 |
| Juni 22 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | -2.115,66 | 17.341,78 |
| Juli 22 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | -1.224,33 | 891,32 |
| August 22 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,33 |
| September 22 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 22 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 22 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 22 | 2,82 | 0,50 | 0,09 | -3.907,91 | -3.907,91 |
| Januar 23 | 5,67 | 0,52 | 0,06 | -11.257,96 | -7.350,05 |
| Februar 23 | 1,38 | 1,74 | 0,18 | -21.882,25 | -10.624,29 |
| März 23 | 4,22 | 0,74 | 0,14 | -23.227,15 | -1.344,90 |
| April 23 | 6,96 | 0,10 | 0,05 | -34.930,99 | -11.703,84 |
| Mai 23 | 10,06 | 0,01 | 0,01 | -28.745,51 | 6.185,49 |
| Juni 23 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | -2.440,70 | 26.304,80 |
| Juli 23 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | -1.888,63 | 552,07 |
| August 23 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,63 |
| September 23 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 23 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 23 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember | 3,39 | 2,83 | 0,28 | -4.701,28 | -4.701,28 |
| Januar 24 | 3,46 | 0,56 | 0,07 | -11.927,76 | -7.226,48 |
| Februar 24 | 4,82 | 1,06 | 0,29 | -18.895,36 | -6.967,61 |
| März 24 | 6,54 | 0,02 | 0,00 | -27.025,08 | -8.129,72 |
| April 24 | 10,09 | 0,03 | 0,01 | -44.597,27 | -17.572,19 |
| Mai 24 | 11,05 | 0,06 | 0,02 | -31.844,53 | 12.752,74 |
| Juni 24 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | -3.141,15 | 28.703,38 |
| Juli 24 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | -2.083,80 | 1.057,35 |
| August 24 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,80 |
| September 24 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 24 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 24 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 24 | 4,12 | 0,26 | 0,15 | -5.708,90 | -5.708,90 |
| Januar 25 | 2,80 | 0,91 | 0,29 | -11.702,57 | -5.993,67 |
| Februar 25 | 2,07 | 0,55 | 0,02 | -24.510,04 | -12.807,47 |
| März 25 | 3,73 | 0,43 | 0,12 | -28.482,02 | -3.971,98 |
| April 25 | 7,52 | 0,02 | 0,01 | -39.378,08 | -10.896,06 |