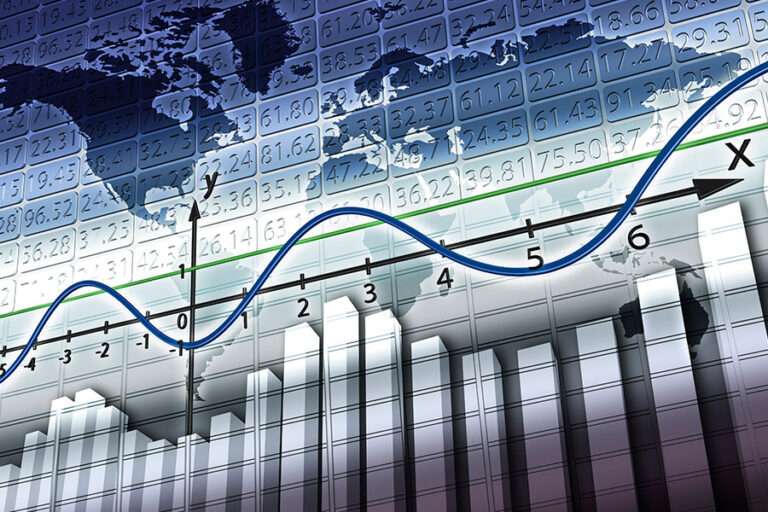Die Covid-19-Pandemie hat die Bedeutung des Themas „Gesundheit am Arbeitsplatz“ in vielfacher Hinsicht hervorgehoben. In kürzester Zeit mussten Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden, beispielsweise die räumliche Trennung von Arbeitsplätzen oder die Verlagerung von vielen Tätigkeiten ins Homeoffice. Darüber hinaus ging die Pandemie mit einer Reihe von Unsicherheiten für Betriebe und Beschäftigte einher. Der betriebliche Gesundheits- und Infektionsschutz wurde nicht selten zur Grundvoraussetzung wirtschaftlichen Handelns. Im Rahmen der Veranstaltung soll unter anderem diskutiert werden, welche mittel- und langfristigen Folgen die Pandemie für die Organisation von Arbeit hat, welchen nachhaltigen Stellenwert das Thema Gesundheit dabei einnimmt und mit welchen Herausforderungen Betriebe und Beschäftigte im Nachgang der Pandemie konfrontiert sein werden.
Jahr: 2022
Betriebe mit ausländischen Beschäftigten stellen häufiger Geflüchtete ein
Rund 8 Prozent der Betriebe, die bereits Erfahrung mit ausländischen Arbeitskräften gemacht haben, stellen auch Geflüchtete ein. Bei Betrieben ohne diese Erfahrung ist der Anteil mit knapp 2 Prozent deutlich geringer. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.
Mögliche Gründe für die höhere Wahrscheinlichkeit von Betrieben, Geflüchtete zu beschäftigen, wenn sie bereits Erfahrungen mit ausländischen Beschäftigten gemacht haben, können zum Beispiel ein besserer Überblick über institutionelle Regelungen oder der Zugang zu informellen Such- und Besetzungswegen über bereits im Betrieb beschäftigte ausländische Personen sein. „Diese Betriebe können möglicherweise im Ausland erworbene Ausbildungen oder mitgebrachte Arbeitserfahrungen besser einschätzen und informelle Kontakte leichter nutzen“, berichtet IAB-Forscher Sekou Keita. Weitere Gründe könnten sein, dass Geflüchtete in Branchen aktiv sind, in denen die mitgebrachten Fähigkeiten– insbesondere in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft – eher den Stellenanforderungen entsprechen; zum Beispiel, wenn weniger Sprachkenntnisse erforderlich oder manuelle Tätigkeiten besonders gefragt sind.
Die Beschäftigung der Geflüchteten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. In den ersten Jahren seit der Ankunft 2015/2016 waren rund die Hälfte der Geflüchteten in der Zeitarbeit und in überwiegend kleinstbetrieblich strukturierten Branchen wie dem Handel und dem Bau- oder Gastgewerbe tätig. Mit 56 Prozent waren mehr als die Hälfte der Geflüchteten in kleinen Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten tätig. „Insbesondere kleine Betriebe nutzen überdurchschnittlich häufig die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder andere persönliche Kontakte als Suchweg bei der Besetzung von neuen Stellen“, erklärt IAB-Forscher Andreas Hauptmann. Kleine und mittlere Betriebe berichten zudem häufiger von Schwierigkeiten, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden und könnten daher eher zu Kompromissen hinsichtlich formaler Qualifikationsanforderungen und Berufserfahrung bereit sein.
Betriebe, die über ungedeckten Arbeitskräftebedarf berichten, beschäftigen ebenfalls häufiger Geflüchtete. Insbesondere in Regionen in denen die regionale Arbeitslosenquote gering ist. Vor dem Hintergrund unbesetzter (Ausbildungs-)Stellen könnten Geflüchtete somit dazu beitragen, die Arbeitskräftebasis der Betriebe zu stabilisieren.
Die IAB-Studie beruht auf Auswertungen des IAB-Betriebspanels, einer repräsentativen Befragung von jährlich rund 15.500 Betrieben aller Betriebsgrößen und Wirtschaftszweige mit mindestens einer sozialversicherungspflichtig beschäftigten Person.
Die IAB-Studie ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-06.pdf.
Old habits die hard? School guidance interventions and the persistence of inequalities
Social disparities in track choices are a well-known mechanism for the intergenerational reproduction of inequality. School guidance may help reducing such disparities by narrowing information gaps and by reducing the family influence on students’ decision making. We investigate the potential equalizing role of guidance programs by analysing an intervention carried out in Italy, where students are tracked at age 14 and teacher recommendations are non-binding. The intervention took place in 2018 in the city of Turin and involved 40% of all eighth-grade students, shortly before their transition from comprehensive to tracked education. The students attended four two-hour sessions designed to provide them with information about the educational system and related job market opportunities, and to raise their awareness of their aptitudes and inclinations. We expected the programme to be of particular benefit to low socio-economic status (SES) and migrant students and thus to reduce social gaps in track choices. We adopted a mixed-method research design: with quantitative analyses based on a combination of propensity-score-matching and differences-in-differences techniques, we compared the outcomes of comparable students from the 2017 and 2018 cohorts who were or were not exposed to the intervention in order to assess its impact on inequality; additionally, we use qualitative non-participatory observation to unveil the actual content and implementation of the program and the behaviour of the key actors. We find that while the program contributed to reducing indecision, probably by compelling students to reflect more carefully about their decisions during this crucial transition, it did not have any major effect on social inequalities. Results from the qualitative analysis help us shed light on the mechanisms at play behind this lack of effect. In particular, the heavy emphasis placed on current achievement records, dropout risks, and (short-term) labour-market outcomes may counteract the equalizing potential of the program by pushing low-SES and migrant students towards vocational tracks.
Robot imports and firm-level outcomes
We use French data over the 1994-2013 period to study how imports of industrial robots affect firm-level outcomes. Guided by a simple model, we develop various empirical strategies to identify the causal effects of robot adoption. Our results suggest that, while demand shocks generate a positive correlation between robot imports and employment at the firm level, exogenous exposure to automation leads to job losses. We also find that robot exposure increases productivity and some evidence that it may increase the relative demand for high-skill professions.
Das Arbeitsvolumen hat sich 2021 erholt, ist aber noch nicht auf Vorkrisenniveau
Das Arbeitsvolumen ist 2021 um 1,9 Prozent auf 60,6 Milliarden Stunden gestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Covid-19-Pandemie, lag es aber immer noch um 3,1 Prozent niedriger. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.
Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichgeblieben und lag im Jahresdurchschnitt bei 44,9 Millionen Personen. Die Arbeitszeit betrug im Jahr 2021 rund 1.349 Stunden, dies sind 1,9 Prozent mehr als 2020, aber 2,3 Prozent weniger als 2019. Die Teilzeitquote liegt im Vergleich zum Vorjahr mit -0,1 Prozentpunkten etwas niedriger. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten ist 2021 mit 0,1 Prozent schwächer gestiegen als die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten mit 0,4 Prozent.
Gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2021 mehr bezahlte und unbezahlte Überstunden geleistet. Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisteten im Durchschnitt jeweils 20,0 bezahlte und 21,8 unbezahlte Überstunden und näherten sich damit wieder dem Niveau vor der Pandemie an. Im Jahr 2021 wurden von den Beschäftigten im Durchschnitt 0,5 Stunden Guthaben auf den Arbeitszeitkonten abgebaut, im Jahr 2020 waren es noch 3,6 Stunden. Daraus ergibt sich in 2021 eine um 3,1 Stunden längere Arbeitszeit.
Nach ersten vorläufigen Hochrechnungen betrug die Anzahl der Kurzarbeitenden im Jahresmittel 2021 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie rund 1,8 Millionen Personen und war damit im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie mit knapp 150.000 Kurzarbeitenden im Jahresdurchschnitt 2019 immer noch enorm hoch. Gegenüber 2020 liegt sie aber im Mittel um mehr als 1,1 Millionen niedriger. „2021 war der Arbeitsmarkt auf dem Weg einer allmählichen Normalisierung. Im Jahresverlauf stieg die Beschäftigung, die Kurzarbeit ging nach der dritten Welle bis in den Herbst zurück, Arbeitszeitkonten wurden nicht weiter abgebaut“, erklärt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“. „Den Vorkrisenstand hat das Arbeitsvolumen noch nicht wieder erreicht. Mit der Erholung aus der Omikron-Welle wäre dieses Ziel für das laufende Jahr realistisch, die Folgen des Ukraine-Kriegs dürften aber zu einem Dämpfer führen“, so Weber.
Eine Tabelle zur Entwicklung der Arbeitszeit steht im Internet unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/tab-az2021.pdf (nicht barrierefrei) zur Verfügung. Eine lange Zeitreihe mit den Jahreszahlen ab 1991 ist unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/AZ_Komponenten.xlsx abrufbar.
Ankommen im Arbeitsmarkt – was lehrt uns die Erfahrung für die Flucht aus der Ukraine?
Jede plötzliche Fluchtbewegung ist anders, aber können OECD-Länder bei der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine dennoch etwas aus vergangenen Erfahrungen lernen? Jetzt im Krieg ist die Dauer des Verbleibs noch unsicherer als sonst: Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden und einige baldige Rückkehr in ihre Heimat. Eine andere Besonderheit gegenüber der Erfahrung von 2015 ist, dass überwiegend Frauen mit Kindern aus der Ukraine in den Nachbarländern ankommen. Das beeinflusst die Arbeitsmarktintegration, da sie einen geschärften Blick für die Bedürfnisse von Kindern und ihren Müttern oder anderen Begleitpersonen erfordert. Welche Maßnahmen haben Deutschland, Österreich und andere OECD-Länder bereits ergriffen, um dieser besonderen Situation gerecht zu werden? Was können die Länder voneinander lernen?
Sorgearbeit in der Covid-19-Pandemie: Väter beteiligten sich stärker als zuvor, den weitaus größeren Teil leisten weiterhin Mütter
Mütter übernahmen auch während der Covid-19-Pandemie den größeren Teil der Sorgearbeit. Allerdings beteiligten sich Väter vor allem zu Beginn der Pandemie stärker an der Kinderbetreuung. Dies fand insbesondere in Haushalten statt, in denen Mütter mehr als 20 Stunden außer Haus tätig waren und keine Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Der Anteil der Mütter, die vor der Covid-19-Pandemie fast vollständig oder überwiegend die Kinderbetreuung übernahmen, blieb auch im Juni 2020 während der Corona-Krise nahezu unverändert. Sie sank lediglich um 2 Prozentpunkte auf 64,2 Prozent. Der entsprechende Anteil der Väter verdoppelte sich im selben Zeitraum auf 10,5 Prozent. Auch in anderen Bereichen der Sorgearbeit wie der Hausarbeit, dem Einkaufen und häuslichen Reparaturarbeiten beteiligten sich Väter während der Pandemie stärker als zuvor, auch wenn die Veränderungen in der Aufteilung der Sorgearbeit in manchen Bereichen sehr gering waren. Die Ungleichheiten in der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen im Verlauf des ersten Pandemiejahres waren weiterhin hoch. „Für eine weitere Verlagerung der Sorgearbeit hin zu den Frauen bei gleichzeitigem Rückgang des weiblichen Erwerbsumfangs – wie von der Retraditionalisierungshypothese erwartet – finden wir bisher keine empirischen Belege. Mütter kehrten zudem schneller zu ihrer vorherigen Arbeitszeit zurück als Väter“, berichtet IAB-Forscherin Claudia Globisch.
Die stärkere Beteiligung der Väter an der Sorgearbeit näherte sich im Verlauf der Pandemie wieder derjenigen vor der Corona-Krise an. Dennoch blieb die Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung mit 9,7 Prozent im August 2020 höher als vor der Covid-19-Pandemie. „Der wieder abnehmende Anteil der Väter an der Sorgearbeit spricht dafür, dass die beobachtete Ausweitung ihres Engagements eher aus der Notwendigkeit geboren war, und dass sie sich mit einer Normalisierung der Situation wieder zurückbilden dürfte“, erklärt Dana Müller, Leiterin des Forschungsdatenzentrums der Bundesagentur für Arbeit im IAB. „Nichtsdestotrotz haben Maßnahmen wie Homeoffice und angeordnete Kurzarbeit Zeitressourcen geschaffen, die eine stärkere Beteiligung der Väter an der Sorgearbeit ermöglichten“.
Die Ergebnisse beruhen auf den Daten des Hochfrequenten Online Personen Panels (HOPP) „Leben und Erwerbstätigkeit in Zeiten von Corona“. Inhaltlich erfasst die HOPP-Befragung die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Erwerbstätigkeit und die damit zusammenhängenden Aspekte wie die Nutzung von Homeoffice, die Aufteilung der Sorgearbeit aufgrund geschlossener Betreuungseinrichtungen, das Wohlbefinden oder die Gesundheit.
Ein begleitendes Interview mit Claudia Globisch und Michael Oberfichtner finden Sie unter: https://www.iab-forum.de/arbeit-und-familie-im-lockdown. Die IAB-Studie ist online abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2022/kb2022-05.pdf.
European Labour Market Barometer: Aussichten für den europäischen Arbeitsmarkt hellen sich weiter auf
Nach kontinuierlichen Rückgängen von Juni bis Dezember 2021 steigt das European Labour Market Barometer im Februar 2022 zum zweiten Mal in Folge wieder an. Der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nimmt gegenüber Januar um 1,2 Punkte auf 103,0 Punkte zu. Der Zeitraum der dem Barometer zugrundeliegenden Befragung endete Mitte Februar, daher sind mögliche Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch nicht abgebildet.
„Das absehbare Ende von Corona-Einschränkungen in vielen Ländern spricht für eine deutliche Frühjahrsbelebung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs können aber zu einem Dämpfer führen “, berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“. Der Frühindikator des European Labour Market Barometer ist im Februar gegenüber Januar in fast allen teilnehmenden Ländern gleichgeblieben oder gestiegen. In den osteuropäischen Ländern verzeichnet das Barometer überall Zuwächse. Diese Ergebnisse spiegeln allerdings den Stand vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wider.
Ein optimistischerer Ausblick zeigt sich für die Beschäftigung und noch mehr für die Arbeitslosigkeit. „Die Erwartungen der europäischen Arbeitsverwaltungen für die Arbeitslosigkeitsentwicklung haben sich seit Jahresbeginn deutlich verbessert“, so Weber. Der Teilindikator für die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen nimmt im Vergleich zum Januar um 1,6 Punkte auf 102,2 Punkte zu. Der Wert liegt damit erneut über der neutralen Marke von 100 Punkten und deutet auf sinkende Arbeitslosigkeit hin. Der Teilindikator für die saisonbereinigte Entwicklung der Beschäftigung steigt um 0,9 Punkte auf 103,8 Punkte.
Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 17 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Flandern, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, die Schweiz, Tschechien und Zypern. Während Komponente A des Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate signalisiert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus den Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert des Barometers. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). Für jede der teilnehmenden Arbeitsverwaltungen wird ein Barometer bestimmt, aus denen sich das europäische Barometer als gewichtetes Mittel ergibt.
Eine Zeitreihe des European Labour Market Barometer einschließlich seiner Einzelkomponenten für alle 17 beteiligten Arbeitsverwaltungen ist unter www.iab.de/Presse/elmb-components abrufbar. Mehr zum Europäischen Arbeitsmarktbarometer findet sich unter http://doku.iab.de/kurzber/2020/kb2120.pdf.
Regionalstruktur ukrainischer Communities in Deutschland
Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen aus der Ukraine in Deutschland betrug zum
Jahresende 2020 gut 145.000 Personen. Nach den Auswertungen von Brücker et al. (2022) lebten
im Jahr 2018 322.000 aus der Ukraine stammenden Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland, von denen 51.000 in Deutschland geboren sind.
Heterogeneous Impacts of Local Infrastructure Investments: The 2014 Football World Cup in Brazil
We analyze the effects of large-scale local public infrastructure investments on economic development, exploiting the infrastructure shock following when Brazil was awarded the 2014 FIFA World Cup. We place particular emphasis on effect heterogeneity with respect to the type, location, temporal evolution, and costs and benefits of the investments. Using novel data on monthly night light luminosity at the municipal district level as a proxy for economic activity, we apply Difference-in-Differences and event studies for estimation. Overall, we find strongly positive impacts both in the short and longer run. However, a closer examination reveals that effects are larger and longer-lasting for transport infrastructure as opposed to sports infrastructure, and they are more pronounced in smaller areas. Importantly, we quantify significant negative spatial spillovers. Factoring them in, we still find positive net benefits of transport infrastructure investments two years after the tournament.